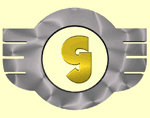Mit Rückenwind zum nächsten Ziel.
Um 9.00 Uhr versammelten wir die Goggos unter dem "Wahrzeichen" von Coober Pedy, einem großen Schriftzug "OPAL CITY" mit daneben aufgebocktem Gebläsetruck. Die Trucks haben einen kräftigen Dieselmotor auf der Ladefläche, mit dem ein sehr leistungsstarkes Gebläse angetrieben wird. Dieses wird mit einem Rohr verbunden, das hinunter in den Schacht führt und von dort das gemahlene Gestein nach oben saugt. Der Staubanteil baut sich vor dem Wagen zu einem Sandhaufen auf, die schwereren Partikel landen in einer Tonne, über die der Luftstrom zum Schluss führt. Den Boden der Tonne kann man öffnen und die Brocken nach Opalen durchsuchen. Der Abbau des Sandsteins unten im Schacht geschieht je nach Finanzkraft des Schürfers mit der Spitzhacke, Sprengstoff oder einer Steinfräse.
Jetzt wisst Ihr, warum ein Opal so teuer ist, wenn Ihr ihn im Schmuckladen kauft. Deutlich billiger kann der Spaß werden, wenn man für 300,- australische Dollar (180,- €) einen 50 x 100 m großen Claim mietet und selbst nach den Opalen sucht. Man hat ein ganzes Jahr Zeit, und wer danach hofft, noch mehr zu finden, kann den Vertrag verlängern. Ansonsten kommt ein neuer Bewerber zum Zuge. Auf diese Weise sind in über hundert Jahren rund 1,5 Millionen (!) mehr oder weniger große Erdlöcher oder Stollen entstanden.
Die Schürfer wohnen anfangs z. B. in Wohnwagen, weil kaum jemand den Erlös für die ersten Opale im Motel ausgeben will. Später, wenn unten schon ausgebeutete Schächte entstanden sind, bauen sich nicht wenige dort eine Wohnung, weil es angenehm kühl ist (oben im Sommer oft mehr als 40 Grad C) und der Schacht ja ansonsten nicht mehr gebraucht wird.
Und es gibt nicht nur Wohnungen unter der Erde, sondern auch Restaurants, Hotels, Kirchen und Läden.
Man muss die Wände nicht verkleiden, das terrakottafarbene Gestein mit seiner rauhen Struktur von der Abbaumaschine sieht ausgesprochen gut aus, da wäre Täfelung oder Tapete fehl am Platze.
Nach den Fotos am Ortseingang nahmen wir wieder den Stuart Highway unter die Räder. Der Gasfuß nahm die längst gespeicherte Stellung für 75 km/h ein und die Fahrt auf glattem Asphalt wurde nur, damit man nicht einschlief, alle 20 bis 30 Kilometer von einem kräftigen Ruckeln unterbrochen. Es entstand immer dann, wenn wir einen "Grid" überfuhren, ein im Straßenbelag eingelassenes Gitter, das den Rindern den Weg zur Nachbarranch verwehren soll, denn über Metallgitter gehen sie nicht. Auf den riesigen Weiden sind zur Abtrennung natürlich Zäune gezogen, aber die lassen sich ja schlecht über die Straße bauen.
Während wir bei bewölktem Himmel gestartet waren, zogen sich die Wolken nun immer weiter zurück. Vorher konnten wir über dem fast unbewachsenen Land bei meilenweiter Sicht noch eine schwarze Regenwolke beobachten, die sich aber weit neben unserer Route abregnete. Scheibenwischer sind hier nur selten nötig.
Wir kamen gut voran, dank eines kräftigen Rückenwinds, der ab und zu einen kugelförmigen, trockenen und entwurzelten Busch über die Fahrbahn trieb, wie man es in jedem Western-Film sieht.
Um 13.15 Uhr war auch diese 250 km-Etappe geschafft, einmal mehr ohne jeden Defekt. Das soll doch wohl nicht einreißen  ?
?
Gelandet sind wir heute in Glendambo, einem typischen Roadhouse mit guten Zimmern und einem gemütlichen Pub. Was braucht man mehr?
Zufrieden grüßen Bine, Bill und Bernd